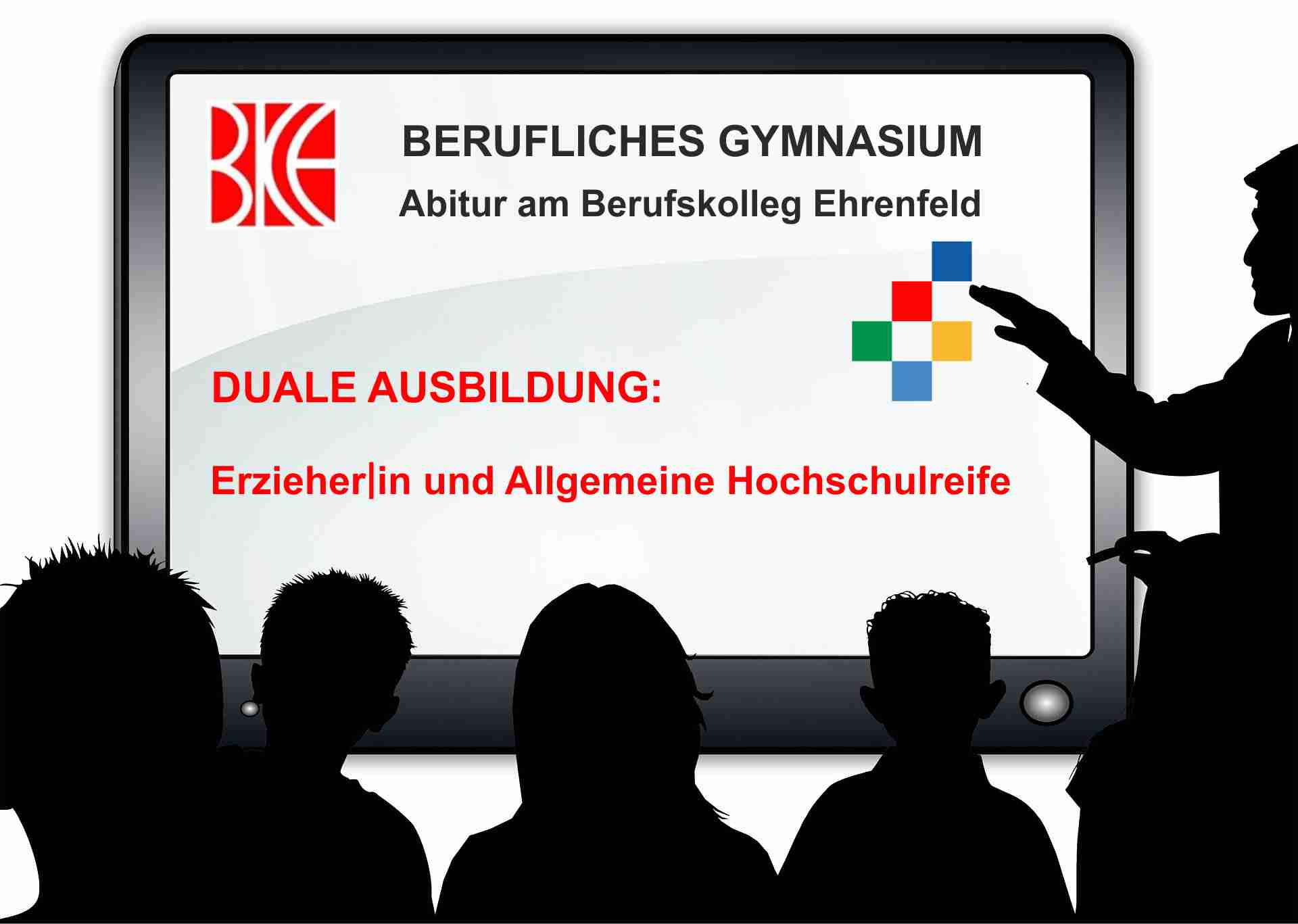Und die Aula war sehr gut besucht: Die Zuhörerschaft bestand aus Schülerinnen und Schülern ganz verschiedener Bildungsgänge mit sehr unterschiedlichen Hintergründen, Nationalitäten, Biografien, Alter und Zukunftszielen.
Und die Aula war sehr gut besucht: Die Zuhörerschaft bestand aus Schülerinnen und Schülern ganz verschiedener Bildungsgänge mit sehr unterschiedlichen Hintergründen, Nationalitäten, Biografien, Alter und Zukunftszielen.
Worum ging es? Grundsätzlich gilt in Deutschland die Meinungsfreiheit. Eine Meinung kann man haben, sie kann politisch links oder rechts verortet, sie kann richtig oder falsch sein, natur- oder geisteswissenschaftlich begründet – und anders als die eigene. Herr Professor Schönecker nahm teils provokante Meinungen zur Hilfe, um zu verdeutlichen, dass man sich einer Diskussion stellen wollen muss, um eine Demokratie zu (er-)tragen. „Tolerare“ ist Lateinisch für „aushalten / ertragen“. Bin ich bereit, andere Meinungen zu ertragen, auch wenn es „weh tut“? Bin ich „beleidigt“, wenn jemand eine andere Meinung vertritt? Muss ich meine Meinung überdenken? Ist sie falsch? Oder werde ich tatsächlich in meinen Bürgerrechten verletzt (- die Würde des Menschen ist unantastbar) und kann rechtlich dagegen vorgehen?
In Zeiten der „cancel culture“, der Nutzung verschiedener Medienkanäle und einer möglichen Gesellschaftsspaltung („Wutwinter“) ist es besonders wichtig, in den Dialog einzutreten. Nur wer seine eigene Position vertritt, kann diese auch überdenken. Nur so können tragfähige Mehrheitsmeinungen gefunden werden.
Dem Vortrag von Professor Schönecker folgte eine offene Fragerunde, bei der er spontan seine Position vertrat und wertschätzend auf sehr durchdachte und differenzierte Fragen der Schülerinnen und Schüler einging.
Das Fazit der Veranstaltung: man muss sich trauen, sich seine eigene Meinung zu bilden – und diese zu verteidigen, indem man gewisse Regeln beachtet. Sie sind nicht neu: Kant und Voltaire waren Vordenker für die Aufklärung und wirken bis heute nach, denn Schule hat als Bildungsauftrag, Schüler und Schülerinnen zu mündigen Bürgern heranreifen zu lassen und sie bei diesem Prozess zu unterstützen. Die künftige Generation wird ihre eigenen Entscheidungen fällen und die Geschicke lenken müssen.
Es bleibt zu wünschen, dass diese Veranstaltung nachhallt – und weiterhin debattiert und gestritten wird, um die eigene Meinung mit Argumenten zu vertreten oder eine andere Perspektive einzunehmen, um im besten Fall einen „kleinsten gemeinsamen Nenner“, einen Konsens herstellen zu können. Hier fassen wir uns am besten „an die eigene Nase“, um weiterhin im Dialog zu bleiben – auch bei einem im Vorfeld umstrittenen Vortrag.
Manuela Lätzsch

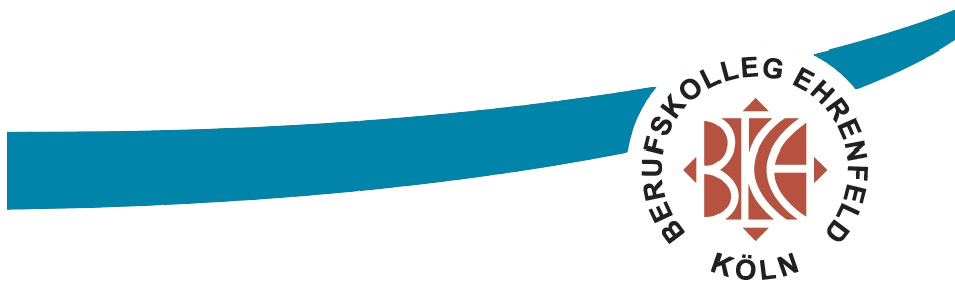 Fit für Ihre berufliche Zukunft!
Fit für Ihre berufliche Zukunft!